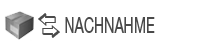Unter chronischer Erschöpfung versteht man einen langanhaltenden Zustand körperlicher und geistiger Müdigkeit, der sich auch durch Schlaf oder Ruhe nicht wesentlich bessert. Die Ursachen sind vielfältig und treten häufig im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen auf. Neben Faktoren wie zB Schlafstörungen, hormonellen oder psychischen Problemen sowie Nährstoffmängeln (z. B. Eisen, Vitamin B12 oder Vitamin D), Burn-out kann auch das Chronische Fatigue-Syndrom (CFS/ME) dahinterstecken.
Die Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) ist eine komplexe Multisystemerkrankung, die Nerven- und Immunsystem betrifft. Typisch für Betroffene ist eine stark eingeschränkte Belastbarkeit, verbunden mit ausgeprägter körperlicher und geistiger Erschöpfung, die mindestens sechs Monate anhält. Abhängig vom Schweregrad kann ME/CFS zu erheblicher Einschränkung im Alltag, Bettlägerigkeit und sogar Pflegebedürftigkeit führen.
Das Chronische Fatigue-Syndrom ist heute als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Dennoch sind die genauen Ursachen bislang nicht vollständig geklärt. Vermutet wird ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren – sowohl genetischer als auch umweltbedingter Natur. Ein Teil der Patient:innen berichtet von einem plötzlichen Krankheitsbeginn, etwa nach einer Virus- oder Bakterieninfektion, einer Operation, einem Trauma oder hormonellen Veränderungen. Bei anderen Betroffenen entwickelt sich die Erkrankung schleichend, sodass der Auslöser nicht eindeutig festzumachen ist.
Hauptkriterien
Die ausgeprägte Erschöpfung oder Müdigkeit:
- besteht länger als sechs Monate
- beruht nicht auf einer körperlichen Überlastung oder auf einer körperlichen Erkrankung
- bessert sich nicht durch Ruhe und Erholung
- bedingt eine erhebliche Einschränkung der Aktivitäten im Alltag und im Beruf
Long-COVID und ME/CFS
Schätzungsweise ein bis zehn Prozent der COVID-19-Erkrankten entwickeln im Anschluss ein Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Der genaue Zusammenhang ist noch nicht vollständig erforscht, allerdings ähneln sich die Symptome von Post-COVID-Syndrom und ME/CFS in vielerlei Hinsicht.
Typische Symptome
Der „Crash“ (Post-Exertional Malaise, PEM)
Charakteristisch für ME/CFS ist eine Fehlregulation von Nervensystem, Immunsystem und Stoffwechsel. Betroffene leiden unter massiver Erschöpfung und stark eingeschränkter Belastbarkeit, die sich auch durch Ruhe nicht bessert. Nach körperlicher oder geistiger Aktivität kommt es häufig zu einer Zustandsverschlechterung – dem sogenannten „Crash“. Dieser kann unmittelbar oder mit Verzögerung (12–72 Stunden) nach einer Anstrengung auftreten, die zuvor noch verträglich war. Ein „Crash“ dauert oft Stunden, Tage oder sogar Wochen an und kann den Gesundheitszustand dauerhaft verschlechtern. PEM gilt als Leitsymptom, das ME/CFS von anderen Fatigue-Erkrankungen unterscheidet.
Kreislaufinstabilität
Viele Patient:innen können ihre Kreislauffunktion nicht über längere Zeit stabil halten. Dadurch wird insbesondere das Gehirn unzureichend mit Blut versorgt. Manche Betroffene entwickeln beim Stehen einen zu schnellen Puls (POTS), andere leiden unter Blutdruckabfällen bis hin zur Ohnmacht.
Kognitive Einschränkungen („Brain Fog“)
Häufig treten Konzentrations- und Gedächtnisprobleme auf. Dazu gehören Wortfindungsstörungen, verlangsamtes Denken und Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung.
Erhöhte Infektanfälligkeit
Patient:innen berichten über eine größere Anfälligkeit für Infekte mit Symptomen wie Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen oder Husten.
Chronische und akute Schmerzen
Nach Belastung, aber auch unabhängig davon, können Schmerzen in Muskeln, Gelenken, Knochen oder im Kopf- und Halsbereich auftreten. Viele Betroffene reagieren zudem empfindlich auf Reize wie Licht oder Geräusche.
Schlafstörungen
Trotz ausgeprägter Müdigkeit sind Ein- und Durchschlafstörungen häufig. Der Schlaf wird zudem als wenig erholsam empfunden.
Magen-Darm-Beschwerden
Viele Betroffene leiden unter Beschwerden, die einem Reizdarm-Syndrom ähneln. Dazu gehören Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, Blähungen oder Übelkeit.
Wege aus der Erschöpfung
Pacing
„Pacing“ gilt als wichtigste Maßnahme im Umgang mit ME/CFS. Dabei geht es nicht darum, die eigene Aktivität zu steigern, sondern vielmehr darum, die persönlichen Belastungsgrenzen zu erkennen und zu respektieren. Feste Regeln oder allgemeingültige Ziele gibt es nicht – Pacing ist immer individuell. Hilfreich ist es, eine Routine zu entwickeln und ein Gespür für die eigenen Grenzen zu bekommen. Bei leichteren Krankheitsverläufen bedeutet das beispielsweise, vor und nach anstrengenderen Tätigkeiten bewusst Pausen einzulegen. Schwer Betroffene reagieren hingegen bereits auf minimale Reize mit einem „Crash“ – ihr Pacing unterscheidet sich daher stark von milderen Verlaufsformen.
Medikamentöse Therapie
Da bislang keine ursächliche Behandlung existiert, konzentriert sich die Therapie bei ME/CFS in der Regel auf die Linderung einzelner Symptome.
Quelle: DA